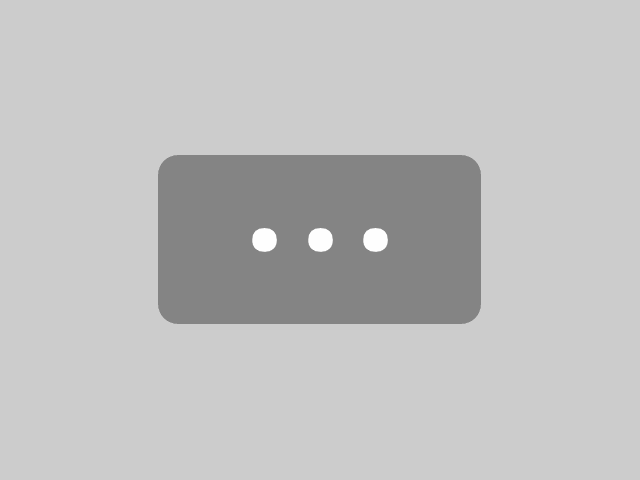“Wenn ich sehe, dass jemand sehr akribisch arbeitet, sich aufopfert im Job und ambitioniert ist, dann decke ich ihm mit Überzeugung den Rücken.”
Das sagte Fredi Bobic vor dem letzten Bundesligaspieltag der Schwäbischen Zeitung, und er meinte Bruno Labbadia. Er sagte auch noch einiges mehr, zum Beispiel, dass Labbadia oftmals jungen Spielern “anhand von TV-Analysen zeigt, was sie besser machen können … das sind Dinge, die nicht mal der ein oder andere sogenannte Konzepttrainer macht.”
Nun weiß ich nicht genau, wen Bobic mit den sogenannten Konzepttrainern meint, und weiß demzufolge erst recht nicht, was diese in ihrer täglichen Arbeit so tun. Im Grunde würde es mich überraschen, wenn sie ihren Nachwuchsspielern nicht in Form von Videoanalysen den Spiegel vorhielten, aber Bobic wird schon wissen, was er sagt. Den obligatorischen Hinweis, dass ich noch immer hoffe, auch Bruno Labbadia orientiere sich an einem Konzept, erwähne ich nur der Vollständigkeit halber.
Ein bisschen erinnert mich das Interview an einen Arbeitgeber, der einem scheidenden Mitarbeiter ein gutes Zeugnis mit auf den Weg geben möchte, sich dabei aber ein wenig verheddert. Bobics Wertschätzung für den Trainer klingt durch, er geht auf die Rahmenbedingungen und Labbadias unbestrittene Verdienste ein, und doch: akribische Arbeit? Opfert sich im Job auf? Ist ambitioniert? War er vielleicht sogar pünktlich? Stets bemüht?
Sicher, ich übertreibe. Gewiss, ich habe selektiv zitiert. Aber so’n bisschen mehr über relevante Qualitäten des Trainers hätte er schon sagen können, so er sie denn sieht. Verzeihung, relevant ist Akribie schon. Auch Pünktlichkeit ist relevant. Notwendig, sogar. Nur nicht hinreichend. Die Weiterentwicklung junger Spieler und eine eigene Handschrift (wenn es denn eine geeignete wäre) könnten indes hinreichend sein. Leider liefert jedoch das Interview keine hinreichende Erklärung der Handschrift. Dabei wäre sie notwendig. Im Gegensatz zu diesem verqueren Absatz.
Vermutlich würde auch Bruno Labbadia unterschreiben, dass er mit der Handschrift, die man am Samstag möglicherweise hätte erahnen können, nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Bei Thomas Tuchel, dessen Mannschaft einen Fußball spielte, der auf mich wesentlich strukturierter, vielleicht auch intelligenter, was immer das heißen mag, wirkte, könnte das anders sein. Er dürfte sich die durch das Mainzer Tun insbesondere zu Spielbeginn offenbarte Handschrift gerne – und zurecht – zuschreiben lassen. Dass den Mainzern die Stuttgarter Trägheit dabei wunderbar in die Karten spielte, ist unstrittig. Und dass Trägheit nicht unbedingt zu den Eigenheiten von Labbadias Handschrift zählt, will ich ihm hier gerne zugestehen. Die Mannschaft war einfach im Kopf nicht ganz da, und ich kann es ihr nicht einmal verdenken.
Dann bekommt man halt ein Tor, nachdem ein eigener Innenverteidiger zunächst noch an der Mittellinie protestierte, anstatt gegen den Ball zu spielen, ein Tor, bei dem 4 oder 5 Weiße den im Grund schon nicht mehr gefährlichen Angriff zu leichtfertig laufen lassen und zwei Blauen beim Torschießen zusehen. Dann bekommt man eben ein zweites Gegentor, bei dem einige keine gute und der Torwart eine, nun ja, lustige Figur abgeben. Jener Torwart, der zuvor schon Glück hatte, nicht vom Platz gestellt zu werden, als er einen Ball völlig falsch eingeschätzt und außerhalb des Strafraums mit der Hand gespielt hatte, und der sich kurz darauf einen hohen Ball selbst ins Netz statt über die Latte gelöffelt hätte, wäre ihm nicht ein Verteidiger zur Seite gesprungen. Wird bestimmt alles besser in Berlin.
Immerhin: man wehrte sich, spielte zwar noch immer verdammt viele Fehlpässe oder schaffte es, wie Gotoku Sakai, drei oder vier Bälle völlig unbedrängt bei der Annahme ins Aus springen zu lassen, zeigte aber auch, dass man das Spiel gelegentlich schnell machen und dann auch konsequent abschließen kann (Boka!). Faszinierend die zweite Hälfte, als man sich wünschte, dass wenigstens eine der beiden Mannschaften in der Lage wäre, mal einen schnellen Angriff – Räume waren im Überfluss vorhanden – konsequent zu Ende zu spielen. Kurz: ein typisches letztes Saisonspiel bei nahezu entsprechenden Temperaturen.
Typisch für einen letzten Spieltag war auch das Geschehen auf den anderen Plätzen. Tore im Minutentakt, speziell in der ersten Hälfte, entschädigten für vieles, was man im Neckarstadion an Aktivität und Attraktivität vermisste, und ein bisschen fühlte man sich wie in der guten (?) alten Radiokonferenz. Champions League, Europa League, Abstieg – es ging hin und her, die Spannung war groß, die Ereignisse zahlreich, die Präferenzen im Stadion deutlich vernehmbar. Bei Schalke und Freiburg schienen sich viele schwer zu tun, Frankfurt hatte wohl leichte Vorteile gegenüber dem HSV, nur bei Hoffenheim schien sich der Großteil der Zuschauer in seiner Aversion einig. Umso spannender, dass sich gerade dort die Ereignisse zum Ende hin überschlugen, sodass die Fans, die das Treiben ihres VfB über weite Strecken vergleichsweise teilnahmslos verfolgten, auf diesem Wege einige Aggressionen loswerden konnten.
Nach dem Spiel äußerte ich meine Begeisterung über das nachmittägliche Geschehen via Twitter:
– was, nicht nur aus Sicht der gerade Abgestiegenen oder anderweitig Gescheiterten verständlich, keine uneingeschränkte Zustimmung erfuhr. Gleichwohl: solche Geschehnisse, gerade die in Dortmund, sind es doch, die einen ganz erheblichen Teil dessen ausmachen, was uns am Fußball so fasziniert. Freiburger Fans werden ihren Enkeln dereinst davon erzählen, wie Julian Schusters kurioses Eigentor die erste Champions-League-Qualifikation ihres Vereins verhinderte (wobei: möglicherweise erzählen Freiburger Fans ihren Enkeln auch auf Jahrzehnte hinaus nur von Christian Streichs Pressekonferenzen), und den nächsten Generationen Hoffenheimer Anhänger (hier darf sich jeder, dem so etwas gefällt, gerne einen beliebigen Witz mit den Schlagworten Hoffenheim, Fans, Tradition und Hopp denken) könnten, ein erfolgreiches Bestreiten der Relegation vorausgesetzt, ob der Namen Gisdol, Schipplock, Salihovic und nicht zuletzt Großkreutz irgendwann die Ohren bluten.
Ich selbst bin, um damit nicht hinter dem Berg zu halten, recht zufrieden mit dem Ausgang des letzten Spieltags. Ich freue mich, dass Frankfurt und Armin Veh für ihre starke Saison belohnt wurden. Freiburg hätte ich Platz vier gegönnt, verhehle aber nicht, dass auch Jens Kellers Weg mit den Schalkern aller Ehren wert ist. Dass ich letztlich ohnehin jede Platzierung, die man nach 34 Spielen erreicht, für verdient halte, wissen diejenigen, die hier mit einer gewissen Regelmäßigkeit mitlesen, ohnehin.
Und so verneige ich mich ziemlich tief vor Markus Weinzierl und seinen Augsburgern, bedaure die Düsseldorfer Fans, deren Verein zu lange eine zu schlechte Figur abgegeben hat, um bei mir einen nennenswerten Abschiedsschmerz auszulösen, und beglückwünsche Hoffenheim, das nicht nur den Trend und möglicherweise ein wenig den Spielplan zum Freund hatte, das auch nicht nur die sich bietende Chance entschlossen beim Schopf packte, sondern das auch seit Wochen Anzeichen einer einkehrenden Vernunft und entsprechenden Neuorientierung aussendet. Dass mich ganz nebenbei auch die Bayern mit ihrer überragenden Saison beeindruckt haben, ergänze ich gerne, auf all die anderen will ich jetzt nicht weiter eingehen.
Kurz eingehen möchte ich aber noch auf die VfB-Spieler, die sich mit einem sehr gelungenen Video bei den Fans bedankten (wie mittlerweile wohl jeder weiß):
Interessant, wie sie sich am Spieltag nach der Ankündigung des Videos im Mittelkreis sammelten, in – wie ich meine – gespannter Erwartung der Reaktion derjenigen, die sie da porträtierten (der Umstand, dass mir kein passendes Verb aus der Wortfamilie der »Hommage« bekannt ist, ersparte mir die Entscheidung, ob ich das Porträt vielleicht gar zur eben genannten erheben solle), in gespannter Erwartung, wie sie Kindern eigen ist, die etwas für ihre Eltern gebastelt haben und eigentlich wissen, dass diese begeistert reagieren werden, die aber doch, wegen irgendeiner Kleinigkeit (Mamas gute Stoffreste verwendet?), einen Ticken © Nervosität verspüren. Was natürlich völlig unnötig ist.
Was mir tatsächlich am besten gefallen hat: die Trikotvielfalt. Cacau mit diesem furchtbaren goldstichigen Göttinger-Gruppe-Verbrechen, Röcker als Verlaat, dann natürlich Südmilch, selbst das weinrote Gazi, Ulreich im gelben debitel – fast wie im richtigen Leben, die einfache Variante mit aktuellen Trikots (und dem aktuellen Sponsor) vermeidend.
Und am allerbesten, einmal mehr: Martin Harnik. Ich hatte überlegt, diesen Text ganz anders zu schreiben, unter der Überschrift “Ode an Martin Harnik”. Allein: ich weiß nicht, wie man eine Ode schreibt. Sagte ich hier übrigens schon einmal, in anderem Zusammenhang. Irgendwann muss ich mich wohl doch mal daran versuchen. Bis dahin sammle ich einfach weiterhin öffentliche Auftritte von und mit Martin Harnik, mit dem Wunsch, dass sie jedem anderen Berufsfußballspieler zum Selbststudium ans Herz gelegt werden mögen. Könnte allerdings auch deprimierend werden.